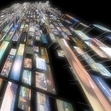Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Ist die Realität noch zu retten?


Prof. Dr. Jan Söffner
Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse
- Zur PersonProf. Dr. Jan Söffner
Professor Dr. Jan Söffner, geboren 1971 in Bonn, studierte Deutsch und Italienisch auf Lehramt an der Universität zu Köln. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss promovierte er am dortigen Romanischen Seminar mit einer Arbeit zu den Rahmenstrukturen von Boccaccios „Decamerone“. Die nächsten drei Jahre führten ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter an das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung nach Berlin. Zurückgekehrt an die Universität zu Köln, erfolgte neben einer weiteren wissenschaftlichen Tätigkeit am Internationalen Kolleg Morphomata die Habilitation. Jan Söffner übernahm anschließend die Vertretung des Lehrstuhls für Romanische Philologie und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen und leitete Deutsch- und Integrationskurse für Flüchtlinge und Migranten an den Euro-Schulen Leverkusen. Zuletzt arbeitete er erneut am Romanischen Seminar der Universität zu Köln und als Programmleiter und Lektor beim Wilhelm Fink Verlag in Paderborn. An der ZU wird Professor Dr. Jan Söffner zur Ästhetik der Verkörperung, zur Kulturgeschichte sowie zu Literatur- und Theaterwissenschaften lehren und forschen.
- Mehr ZU|DailyWenn die Realität die Krise kriegt!Von Fake News bis zur Selbstinszenierung im Internet – was ist da überhaupt noch real? Die ZU-Professoren Karen van den Berg und Jan Söffner gehen dem Phänomen in einer neuen Ringvorlesung auf den Grund.Zwischen Realität und InszenierungVernetzte Computersysteme sind aus der hochtechnologisierten Welt nicht mehr wegzudenken. Ganze Infrastrukturen werden zu möglichen Angriffszielen. Johannes Lynker hat untersucht, welche Gefahren tatsächlich drohen.Neue Medien verstehen lernenDas Mohammed-Schmähvideo mit seinen Folgen ist ein Phänomen der mediatisierten Moderne. Professor Dr. David L. Altheide sagt, Medien vereinfachten die Realität so sehr, bis ein falsches Bild entstehe.
Ist die Realität noch zu retten? Totgesagt war sie schon öfter: Den Surrealisten war sie zu schnöde und zu belanglos, für radikale Konstruktivisten war sie eine billige Ontologisierung, für Dekonstruktivisten eine verachtenswerte Metaphysik, nach Ansicht von Medientheoretikern war sie ein Begriff, der angesichts des Siegeszugs der Virtualität dahinschmolz. Doch der Literaturwissenschafter Albrecht Koschorke, Initiator einer Forschergruppe zum Realen in der Kultur der Moderne, machte die Ansicht plausibel, dass alle diese Kampfansagen eigentlich eher Anzeichen für die ungebrochene Vorherrschaft des Begriffs waren. Die Totgesagte musste man nur deshalb so laut totsagen, weil sie sehr lebendig war.
Doch haben diese Zeiten sich geändert. Der journalistische Faktencheck genießt auf einmal so hohes Ansehen, sodass die 2012 eingestellte und zum Ausstrahlungszeitpunkt eher maue Comedy-Serie „FCU: Fact Checkers Unit“, wenn man sie heute wieder betrachtet, tatsächlich fast komische Dimensionen entfaltet. In der Philosophie diskutiert man einen „Neuen“ und einen „Spekulativen Realismus“. Er vertritt den eigentlich unspektakulären, aber für die alten Angriffe auf die Realität provokanten Gedanken, dass es eine Welt gibt, die auch ohne Menschen und deren Denken auskommt. In den Geisteswissenschaften erscheint Sammelband um Sammelband zur Poetik und Philosophie des Realismus. In den Kulturwissenschaften wird – im Angesicht von Klimawandelleugnern und „White supremacy“-Populisten – die Realität wieder zum attraktiven Referenzpunkt.
All dies zeugt davon, dass die Realität wackelt. Sie ist nicht mehr selbstverständlich. Zeitgleich mit dem Erdzeitalter-Begriff des Anthropozäns hat sich der Begriff des Postfaktischen – oder auf Englisch der „post-truth“ – schon fast als Epochenbeschreibung etabliert. Und wo der erste die vom Menschen willkürlich verformte Welt bezeichnet, geht es beim zweiten um das vom Menschen willkürlich verformte Wissen über sie. Die Realität scheint zu einer bedrohten Lebenswelt geworden zu sein. Und so braucht es nicht zu wundern, dass fast die gleiche intellektuelle Gemeinschaft, die den Begriff der „Realität“ noch vor kurzem als schnöde, billig oder metaphysisch kritisierte, sich nun dem Versuch verschrieb, sie wenigstens in akademischen Reservaten intakt zu halten.

Vielleicht ist dies ein guter Moment, etwas nüchterner zu überlegen, was der Begriff der Realität überhaupt genau besagt, woher er stammt und wozu er gut ist oder war. Es kann überraschen, wie jung er ist. Ein Verständnis von Realität im heutigen Sinne etablierte sich erst vor rund zweihundert Jahren. Gewiss: Das Wort ist älter. Doch bei seiner Prägung durch den hochmittelalterlichen Philosophen Duns Scotus bedeutete realitas noch etwa so viel wie Dinghaftigkeit. Die realitas eines Dings war das, was es überhaupt erst zum Ding machte; und das war für eine Philosophie, die sich noch nicht von der Theologie getrennt hatte, der Bezug zu Gott.
Erst seit Immanuel Kant rückt das menschliche Subjekt konsequent an Gottes Stelle in der Gleichung: Ein Ding ist seither nicht mehr einfach da, sondern es wird erst dadurch zum Ding, dass ein Subjekt sich auf es bezieht. Real ist seither das, worauf man sich als außenweltliche Gegebenheit bezieht. Da eine solche aktive Bezugnahme erstens nicht nur von Subjekten, sondern auch von ganzen Gesellschaften geleistet werden kann, war es von hier aus ein kurzer Weg zum literarischen Realismus; und da der Bezug zweitens letztlich immer einer Konstruktion gleichkommt, war auch der Weg zum Konstruktivismus gebahnt.
Doch gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Hätte Scotus in Byzanz gelebt und griechisch geschrieben und gedacht, wäre es zu einem solchen Begriff der Realität vermutlich nie gekommen. Denn das Altgriechische hatte keinen Begriff für Dinge, auf die man sich nur bezieht. Die Philosophie sprach vom Sein (ousia), von Gütern (chremata), vor allem aber von Dingen, die man tat – von pragmata. Bedenkt man diesen Umstand, dann erkennt man die Beschränkung des Begriffs der Realität. Er bezeichnet nicht die Dinge, die man tut – sonst hieße er Praxis. Will man also die Realität als maßgeblichen Begriff des Weltzugangs durchsetzen, muss man die Dinge, die man tut, „übersetzen“: in Dinge, auf die man sich bezieht.
Genau das ist es, was seit zweihundert Jahren unter dem Schlagwort des „Realistischen“ geschieht. Das vielleicht anschaulichste literarische Narrativ, das dieses Problem verdeutlicht, ist die im 19. Jahrhundert erfundene Gattung der Detektivgeschichte. Detektive sind Helden, deren Heldentat darin besteht, Dinge, die jemand getan hat, in Dinge zu verwandeln, auf die sich ein Interpret bezieht. Auch in formaler, poetischer Hinsicht machten die Bewegungen des Realismus die Bezugnahme auf das Gegebene zum Austragungsort der Kunst, was selbstverständlich nie ganz unproblematisch war.
Für die Tragödie von Sophokles bis zu Schiller war es noch das vornehmliche Ziel gewesen, Taten und Handlungen in eine prägnante Form zu bringen – wofür die historische Realität bei Bedarf verbogen werden konnte. Im realistischen Drama wird Prägnanz der Handlung ersetzt durch Prägnanz der (realistischen) Darstellung. Das hat zur Folge, dass historische Fakten nicht mehr so leicht geopfert werden konnten und selbst die Bühnensprache sich – eben – „realistisch“ geben musste. Das heißt, dass sie auf Kosten rhetorischer Eleganz oder argumentativer Klarheit echt zu wirken hatte. Das Spiel ließ sich sogar so weit treiben, dass Rede und Handlung über ihre Prägnanz auch ihre Plausibilität völlig verloren: Das absurde Theater war geboren.
Tatsächlich wurde die Realität in den vergangenen zweihundert Jahren derart auf Kosten der pragmata naturalisiert, dass die Entwicklung auch komische Blüten treibt. Es ist heute schier unmöglich, Schulklassen bei einer Sophokles-Analyse die Ansicht auszutreiben, dass die Ödipus-Handlung doch „unrealistisch“ sei. In der analytischen Philosophie wird seit längerer Zeit im Ernst die Frage diskutiert, ob man denn beweisen könne, dass es eine Außenwelt überhaupt gebe, oder man sich nicht bloß auf eine Illusion beziehe – eine Frage, die voraussetzt, dass Handeln entweder überhaupt keine Rolle spielt oder nichts anderes als eine Bezugnahme sei, sonst wäre sie widersinnig. Und als mein Fußballverein wieder einmal abstieg, witzelten die Fans, dass sie „Erste Liga“ gar nicht mehr sehen könnten: All diese präzisen Schüsse, eleganten Ballannahmen und umgesetzten taktischen Anweisungen: Das sei doch unrealistisch.

Die Beispiele zeigen, an welchen Stellen der Übersetzungsakt von Dingen, die man tut, in Dinge, auf die man sich bezieht, noch immer scheitert. Sie zeigen die Schwächen eines zu flächendeckend eingesetzten Begriffs der Realität: Für diesen zählt nicht die Handlung als solche, sondern immer nur die Handlung als Darstellung, Aufführung oder zumindest als Vorstellung. Aber die Beispiele zeigen auch: Eigentlich sind wir noch nie real gewesen – so sehr wir auch versuchen, uns so zu begreifen.
Verbirgt sich hinter der gegenwärtigen „Krise“ des Realismus vielleicht eine besonders unerträglich gewordene Unverrechenbarkeit zwischen res und pragmata, zwischen den Dingen, die man tut, und den Dingen, auf die man sich bezieht? Wird das Verhältnis zwischen den beiden gerade neu ausgelotet? Vielleicht ist dieser Gedanke es wert, diskutiert zu werden. Er besagt, dass die gegenwärtige Krise nur vordergründig eine Krise der Fakten ist. Vielmehr ist das Verhältnis zwischen den Dingen, die man tut, und den Dingen, auf die man sich bezieht, unklar und verwirrend geworden.
Vielleicht spricht das derzeit immer lautstärker ausgerufene Ende der postheroischen Zeit, spricht die Flut der Superhelden in den Medien, spricht die Rückbesinnung auf eine Politik der Taten, spricht die Heldenrhetorik rechtspopulistischer Politiker und sprechen die Heldenfeiern terroristischer Organisationen für eine solche Entwicklung – denn offenbar wird hier die Politik nicht mehr auf eine Faktenwahrheit verpflichtet, sondern auf eine Authentizität der Tat.
Dies ist natürlich eine gewagte These. Aber was besagt eigentlich der Begriff einer „postfaktischen“ Politik? Doch wohl vor allem, dass politisches Handeln sich von den Dingen emanzipiert, auf die es sich bezieht. Erinnern kann man hier an die ikonisch gewordene Aussage des Brexit-Befürworters Michael Gove, der den Warnungen von Politologen und Ökonomen entgegenhielt, die Briten hätten Experten satt, will sagen: Sie wollten sich in ihren Entscheidungen nicht mehr am Wissen über die Realität orientieren, und sie sollten es auch gar nicht mehr.
Wie ist es dazu gekommen? Thomas Assheuer schrieb kurz nach der Vereidigung Donald Trumps, der Verlust der Realität zugunsten einer „reality show“ sei das Vermächtnis der Postmoderne und ihrer Verabschiedung der Objektivität. Doch das überschätzt den Einfluss der Intellektuellen auf die Politik – und es unterschätzt die Bedeutung der Dinge, die man tut. Denn die Postmoderne spielte ihre Beliebigkeit immer nur im Reich der Realität durch – nicht aber für die Praxis. Ein „anything goes“ hat es für die Dinge, die man tut, kaum je gegeben. Ob naturwissenschaftliches Wissen mehr als nur ein willkürliches Konstrukt war, das ließ sich lang und breit ausdiskutieren – Mülltrennung und Umweltpapier waren nicht verhandelbar.
Genau das aber wandelt sich in der Politik des Postfaktischen. Maßgeblich für sie ist nämlich gerade nicht (oder: nicht nur) der laxe Umgang mit Fakten, sondern die Beliebigkeit der Dinge, die man tut. Insofern ist das Wort „postfaktisch“ irreführend. Die Dinge, auf die man sich bezieht – die Fakten –, sind gar nicht der maßgebliche Austragungsort dieser Politik. Davon zeugt nicht zuletzt die Beobachtung, welche Effizienz sie darin entwickelt hat, die politisch korrekte Haltung und damit das pragmatische Erbe der Postmoderne als „unrealistisch“ zu brandmarken. Dabei hatte es sich ja nie um eine realistische Rede gehalten, sondern um eine pragmatische: eine, die nicht sagen wollte, wie die Dinge sind, sondern eine, die erreichen wollte, dass sie eines Tages so würden.
Das Missverständnis ist eigentlich ähnlich wie dasjenige beim „unrealistischen“ Fußballspiel: Auch hier gehen die Dinge, die man tut, und die Dinge, auf die man sich bezieht, durcheinander. Und wer wollte leugnen, dass dies auch bei Donald Trumps Tweets der Fall ist, die an der politischen Realität vorbeilaufende Taten simulieren, suggerieren oder gar vollziehen, indem sie Dinge behaupten oder suggerieren, die schwer mit der Realität vermittelbar sind?

Eine solche Ausweitung der Beliebigkeitszone auf das Handeln könnte aber nur ein kurzes Zwischenspiel sein. Trump gehört selbst noch einer von der Postmoderne geprägten, alternden Generation an, die die Grenzen des Beliebigen auszuloten verstand. Diese Generation verliert aber zusehends an Einfluss.
Bedenklicher scheint mir ein anderes, umfänglicheres Ende der Realpolitik zu sein, das sich derzeit abzeichnet. Beobachten lässt es sich bei der neuen paneuropäischen Rechten, beim Brexit-Entscheid und auch auf beiden Seiten des katalanischen Konflikts. Wo eine Orientierung des Handelns durch die Realität fehlt, treten nur allzu leicht für überwunden gehaltene Vorgängerbegriffe der Realität an ihre Stelle. Die Idee einer bestimmten „Wahrheit“ etwa – oder die Vorstellung eines bestimmten „Seins“ in identitärer Spielart. Beide haben sich selten als gute politische Ratgeber erwiesen.
Anstatt eines neuen Realismus brauchen wir ein neues Gleichgewicht zwischen res und pragmata. Wo Fakten zählen, und nur dort, haben Begriffe wie Realität, Identität oder Lüge und Wahrheit ihren Ort. Als res setzen sie sich einer Dialektik des Belegens und Widerlegens aus. Darauf lässt sich pochen. Doch genügt die Realität nicht, um jedwede Praxis aus ihr zu begründen. Wir haben uns in unserer allzu realistischen Haltung zu lange eingeredet, dass genau dies möglich wäre – und damit die gegenwärtige Desorientierung vorbereitet. Um es noch einmal zu sagen: Wir sind noch nie (ganz) real gewesen – und vielleicht ist es an der Zeit, diesen Umstand auf neue Weise anzuerkennen.
Der Artikel ist am 19.08.2018 unter dem Titel „Wir sind nie real gewesen“ in der „Neuen Zürcher Zeitung“ erschienen.
Titelbild:
| Erik Eastman / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Bilder im Text:
| The White House / Washington, DC / Foreign Leader Visits (Gemeinfrei) | Link
| dronepicr / World of Warcraft Legion Gamescom 2017 (CC BY 2.0) | Link
| Marco Verch / flickr.com (CC BY 2.0) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Jan Söffner
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm