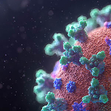Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
In welchem Medium wollen wir arbeiten?


Maximilian M. Locher
Alumnus des Bachelorstudiengangs „Corporate Management and Economics“
- Zur PersonMaximilian M. Locher
Maximilian Locher ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Witten/Herdecke und Berater bei der diskursiven Organisationsberatung Metaplan. Er arbeitet seit Oktober 2017 am Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management und konnte mit dem dortigen Lehrstuhlinhaber zum September 2019 erfolgreich ein BMBF gefördertes Forschungsprojekt zur Digitalisierung in der mittelständischen Produktion (KILPaD) anwerben. In seiner Forschung beschäftigt sich Maximilian Locher qualitativ forschend mit der digitalen Revolution von Organisationen und Gesellschaft. Dabei hat er sich einer interdisziplinären Arbeitsweise zwischen soziologischen, medientheoretischen und philosophischen Theorieressourcen verschrieben.
- FactboxZum Weiterlesen | Über die Medialität des Arbeitens
| Bünning, M.; Hipp, L. & Munnes, S. (2020), Erwerbsarbeit in Zeiten von Corona, WZB Ergebnisbericht, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin
| Cohen, M. D., March, J. & Olsen, J. P. (1972), A Garbage Can Model of Organization Choice, Administrative Science Quarterly, 17(1), S. 1-25.
| Luhmann, N. (1984), Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
| Luhmann, N. (2018) [1998], Die Gesellschaft der Gesellschaft, 10. Aufl., Frankfurt am Main: suhrkamp.
| Rammert, R. (1989), Technisierung und Medien in Sozialsystemen: Annäherungen an eine soziologische Theorie der Technik, in: Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
| v. Foerster, H. (2015) [1993], Wissen und Gewissen, 9. Aufl., Siegfried J. Schmidt (Hrsg.), Frankfurt am Main: Suhrkamp.
| Weber, M. (1972) [1922], Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen: Mohr.
| Wittgenstein, L. (1989), Vortrag über Ethik – und andere kleine Schirften, Joachim Schulte (Hrsg.), Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Mehr ZU|DailyWie wir die Pandemie besiegenVier Experten der Zeppelin Universität haben mit wissenschaftlichen Befunden einen Leitfaden erstellt, um die Krise zu bewältigen. Ein Faktor ist dabei lebensnotwendig.Die Politik der MaskeDie Maske ist längst zum ikonischen Objekt der Covid-19-Pandemie geworden. Doch wie verhält sich die neue Konjunktur der Maske zu ihrer Kulturgeschichte? Und was tun wir eigentlich, wenn wir uns maskieren? ZU-Doktorandin Marie Rosenkranz sieht hier Spielraum – trotz Bedrohung und Zwang.Die „kranke“ Version der LiebeDie Corona-Krise lässt Zeit zum Lesen. ZU-Gastprofessor Hans Ulrich Gumbrecht ist dabei auf ein beliebtes Motiv gestoßen – wie sollte es anders sein: auf die Epidemie. Eine Reise zu Werken von Boccaccio und Kleist bis zu Márquez und Thomas Mann.
In diesen Tagen stolpern wir darüber, wie medienvergessen die Organisation von Arbeit und auch ihre wissenschaftliche Reflexion waren und sind. In welchen Medien in Arbeitskontexten kommuniziert wurde, war eher ein Produkt des Zufalls beziehungsweise des für Organisationen typischen Entscheidens im Sinne des „garbage can“-Modells, wie es die Organisationsforscher Cohen, March & Olsen (1972) beschreiben würden. Die Medienwahl war also weniger bewusst reflektierter Gegenstand planmäßigen Entscheidens und mehr die Folge der Verschränkung von Problemen, Lösungen und Entscheidungsteilnehmern im Angesicht von Entscheidungssituationen:
- Der Koordinationsbedürfnisse unter verschiedenen Arbeitsschritten und der Unverfügbarkeit von Kollegen im Sinne ihrer räumlichen Nähe, ... (Probleme)
- Der Budgets für Reisetätigkeiten oder bestimmte Kommunikationssoftware sowie der Ausstattung mit Apparaten, ob also bloß mit Stift und Papier oder auch mit Telefonanlagen, Smartphones, Laptop, ... (Lösungen)
- Der individuellen, häufig habitualisierten Einschätzungen der Angebrachtheit und Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Kommunikationsmedien für unterschiedliche Kommunikations- und Arbeitssituationen, ... (EntscheidungsteilnehmerInnen)
Die Pandemie um Covid-19 fordert den habitualisierten modus operandi des Wie, der Medialität der Arbeit und ihrer kommunikativen Einbettung heraus. Wo der face-to-face-Kontakt gesundheitliche Risiken beschert, die nicht mehr betrieblich zu rechtfertigen sind, und Festnetzschlüsse am Arbeitsplatz aufgrund der Vermeidung von Wegen zur Arbeit unbesetzt bleiben, stößt die Arbeitswelt (und hoffentlich auch ihre wissenschaftliche Reflexion) darauf, wie sehr Arbeit schon immer medial ermöglicht wie auch bedingt war. Und es müssen Lösungen gefunden müssen, wie trotz der Unverfügbarkeit alter face-to-face-Kommunikationen weiter gearbeitet werden kann.
In beeindruckender Geschwindigkeit wurde nun allerorts neue Kommunikationssoftware lizensiert, installiert und deren technische Möglichkeiten erkundet. Nach einem Moment der Absage und des Cancelns aller Kommunikationsformate der Arbeit macht sich eine neue Euphorie breit: „Es geht auch ohne face-to-face!“ und „Endlich vollziehen wir die nötigen Schritte der Digitalisierung und werden so auch nach der Pandemie arbeiten!“
Die folgenden Zeilen möchten dieser Euphorie nicht widersprechen. Denn für das Problem des Entfallens großer Anteile der face-to-face-Interaktion in der Arbeit wurden Lösungen gefunden und die Arbeitswelt dreht sich weiter. Das ist in dieser Krisensituation schon eine beeindruckende gesellschaftliche Leistung. Im Stile der funktionalen Analyse, die jeder Lösung sozialer Probleme unterstellt, auch eine problematische Seite zu haben, die wieder aufgefangen werden muss, sollen im Folgenden aber Gründe genannt werden, diese Euphorie zu differenzieren. Dafür muss für unser mediales Wie des Arbeitens ein höheres Reflexionsniveau gewonnen werden. Denn ein solches wird umso mehr für den Tag X gebraucht, wenn die Covid-19-Viren unser Interagieren im Angesicht zu Angesicht nicht mehr zu einem schwerlich tragbaren Risiko machen.

Die Mediensoziologie weiß darum, dass keine Kommunikation ohne Medien auskommt. Informationen müssen das eigene System verlassen können, ein Anderer/s erreicht werden und bei diesem ein Unterschied ausgelöst werden. Ob in seinem handelnden oder erlebenden Umgang mit der Welt. Dieses Spiel zwischen Alter und Ego relationiert sich je nach der Wahl des Kommunikationsmediums anders, was im Folgenden an zwei Beispielen illustriert werden soll.
Die Interaktion unter Anwesenden macht wahrscheinlich, dass man die Wahrnehmungen des Gegenübers wahrnimmt, dabei selbst wahrgenommen wird. Somit wechselt sich in der Interaktion unter Anwesenden jede sprachliche Kommunikation ständig mit dieser leiblichen Wahrnehmung von Wahrnehmung ab und korrigiert sich jeweils. Reaktionen werden nahezu instantan. Um diesem Gewusel Herr zu werden und es am Laufen zu halten, entstehen neue Strukturen wie die Differenzierung der Kommunikation in Themen und Beiträge, wodurch ausschließbar wird, was nicht zum Thema passt. All das hat Niklas Luhmann schon 1984 in beeindruckender Form beschrieben.
Die Kommunikation im Medium der Schrift entfernt Alter und Ego der Kommunikation dahingegen voneinander (Luhmann 2018). Wer schreibt und das Geschriebene verbreitet, ist von der unmittelbaren Reaktion auf das Geschriebene abgeschnitten. Der Vorteil, zusätzliche Kommunikationsteilnehmer zu erreichen, wird deswegen mit dem Preis der Vergrößerung der Distanz zwischen den unterschiedlichen Sinnzusammenhängen der Teilnehmer und einer fehlenden unmittelbaren Reagibilität erkauft, die erst wieder mühsam hergestellt werden kann.
Je nach Medium relationieren sich also die Teilnehmer von Kommunikation unterschiedlich zueinander. Werner Rammert (1989) hat beschrieben, dass es in der Folge je nach Kommunikationstechnik zu spezifischen Bedeutungszugewinnen und -verlusten kommt. Wenn wir einander über WebCos sehen, werden wir nicht auf das nervöse Fußtippen aufmerksam, das für strategische Entscheidungen durchaus aufschlussreich sein könnte. Wenn wir über eine Abteilungsdynamik Berichte lesen, verstehen wir die Situation anders, als wenn wir durch die Abteilung hindurchlaufen und wahrnehmen, in welcher Lautstärke, in welcher Intensität und in welchen Formationen tatsächlich interagiert wird.
Medien der Kommunikation sind also alles andere als vollständig äquivalent zueinander. Deshalb kommt es umso stärker darauf an, ihre spezifische Ausformung auf ihre spezifische Leistungsfähigkeit und Folgenhaftigkeit zu reflektieren. Was sind also die jeweils spezifischen Bedeutungsgewinne, was die Bedeutungsverluste, die sich mit der Nutzung von digitalen Kommunikationsmedien wie Zoom, Skype, Webex, Edupip, ... für die digitale Vernetzung von Arbeit ankündigen?
Ein zentraler Bedeutungsgewinn digitaler Kommunikation in der Arbeit stellt sich paradoxerweise in einem Bedeutungsverlust dar. Denn durch den Wechsel in digitale Austauschformate, die zudem häufig von neuen Diskussionsvisualisierungen komplementiert werden, kann die Orientierung an persönlichen Merkmalen zugunsten von sachlichen Inhalten abnehmen. Aufmerksamkeitsschwenke von der Person hin zum Thema werden möglich. Die fehlende Basierung auf der leiblichen Anwesenheit ermöglicht auch, dass ein Zuspätkommen zur Sitzung aufgrund der Anreise nicht mehr zum Fehlen eines Arguments im Workshop führen kann. Einen weiteren Bedeutungsgewinn stellen die Reaktionsmöglichkeiten mit voreingestellten Emojis und instantan plan- und durchführbaren Umfragen dar. Denn durch das digitale Interaktionsformat werden diese Reaktions- und Auswertungsmuster sehr niederschwellig nutzbar und eröffnen so der Kommunikation neue Anschlussmöglichkeiten.
Umgekehrt werden in Bezug auf die Nutzung digitaler Kommunikationsmedien im Arbeitskontext aber auch Bedeutungsverluste ersichtlich.
Wo komplexe Arbeiten im Team anstehen oder auch große Unterschiede in individuellen Orientierungen miteinander verbunden werden müssen, sind belastbare Entscheidungen darauf angewiesen, auch Details der Gestik jenseits des Kameraausschnitts wahrnehmen und thematisieren zu können. Ebenso erscheint die stark sprachbasierte Kommunikation über die meisten digitalen Formate an ihre Grenzen zu kommen, wenn es darum geht, konkrete Sachverhalte an Maschinen oder Patienten zu zeigen und aufzugreifen. Fernwartungssoftware scheint hier Auswege anzubieten, doch die nötige Intimität der Arzt-Patienten-Beziehung scheint sich in ähnlichen Anwendungen der Telemedizin noch kaum auszubilden. Dahingegen scheinen Routinevorgänge wie die bloße Information über Arbeitsfortschritte oder Absprachen zum aktuellen Stand von Arbeitsschritten auch auf die Interaktion unter Anwesenden verzichten zu können.
Informelle Räume wie der Mittagstisch oder der Pausenraum, wie wir sie aus Vor-Corona-Zeiten noch erinnern, sind für das Digitale aber noch kaum in ähnlicher Qualität zu beobachten. Teils werden sie durch entsprechende Zoom-Meetings ersetzt. Doch alleine schon aufgrund ihrer offiziellen Ansetzung scheint die Beiläufigkeit dieser Kommunikationsräume aus dem Analogen verloren zu gehen.

An diesen Beispielen zeigt sich, dass die Adäquanz der Medienwahl mit darüber entscheidet, wie produktiv die Arbeit ist und welche unwahrscheinlichen hochanspruchsvollen Leistungen und auch Kehrtwenden produziert werden können. Wird die Arbeit zu stark zerstückelt, um sie Homeoffice-gerecht zu machen, könnte ihre menschliche Bearbeitung immer stärker durch Maschinen und Software ersetzbar scheinen. Umso wichtiger wird es, nicht so zu tun, als seien Ort und Medium der Arbeit und die damit einhergehenden Bedingungen vollständig substituierbar und wären folgenlos für die Qualität von Arbeit. Allerorts ist wahrnehmbar, dass die Kommunikationsweise, auf die wir uns in unserem Führen, Strukturieren und auch dem Unterführen im Informellen eingerichtet hatten, unwahrscheinlich wird. Damit können auch unsere in dieser Kommunikationsweise bewährten Kompetenzen nicht mehr in Gänze greifen. Dass auch in den neuen Kommunikationsverhältnissen geführt, strukturiert und unterführt werden wird, ist dahingegen klar, nur noch nicht, von wem/was und wie.
Neben diesen funktionalen Erörterungen gilt es auch die ethische Seite der Medienwahl zu reflektieren (zu lernen). Denn die Medienwahl entscheidet auch darüber, wie gut und präzise mit moralisch besonders relevanten Problemstellungen verfahren werden kann. Die Prozessierung von Krisen in Arzt-Patienten-Interaktionen und damit zusammenhängenden Unsicherheiten und moralischen Fragestellungen wird auch weiterhin auf das leibliche Beisammensein angewiesen sein. Vor diesem Hintergrund sind gerade in Ländern mit breiter Versorgungslage, in denen neue Kommunikationstechnologien nicht die Anbindung zusätzlicher Bevölkerungsgruppen an das Gesundheitssystem leisten, allzu euphorische Schritte in die Telemedizin oder digital bedingte Behandlungen kritisch zu reflektieren. Die Intimität des professionellen Erfahrungsraums und das Fernhalten externer Leistungsansprüche, die schon durch das DRG-System und ähnliche Bewegungen schwer gebeutelt wurden, sollte auch in digital „enableten“ Zeiten bewahrt werden. Die Tür zum Sprechzimmer muss geschlossen und damit externe Einflüsse unterbrochen werden können, damit belastungsfähige Vertrauensbeziehungen und jenes von Heinz von Foerster (2015) benannte und von Ludwig Wittgenstein (1989) vorgedachte Phänomen impliziter Ethik entstehen kann.
Neben diesen Fragen der Leistungsfähigkeit digitaler Medien gilt es auch, ihre Folgen für die gesellschaftliche Differenzierung zu beleuchten. Auch wenn diese noch nicht ansatzweise in Gänze beobachtbar sind, so zeigen hier erste Studien wie die des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zu den Folgen des Arbeitens im Homeoffice in Zeiten von Corona wichtige Erkenntnisse auf. Mit der zunehmend digitalen Vernetzung von Arbeit hat sich der Trend zu „work from home“ beziehungsweise „homeoffice“ in zahlreichen Beschäftigungsgruppen enorm beschleunigt. Die Forscher des WZB rund um Mareike Bünning (2020) haben erfasst, dass mit dem Wechsel ins Homeoffice Frauen ihre Arbeitszeiten tendenziell reduzieren und ihre Situation im Homeoffice als deutlich belastender bewerten als Männer. Damit ermöglichen diese Messungen des WZB einen Blick auf die Folge der Entdifferenzierung der Kommunikationsverhältnisse der Erwerbsarbeit und der Kommunikationsverhältnisse des Privaten und Familiären. Max Weber (1972) hatte die Einrichtung des Büros zur Scheidung der „Amtstätigkeit .... von der privaten Lebenssphäre“ geradezu noch als nötigen Schritt zu einer sich rationalisierenden Bürokratie beschrieben. Dieser Schritt scheint rückgängig gemacht zu werden.
Wo aber in der Arbeit der Wechsel ins digitale Arbeiten von einem leiblichen Rückzug in das Homeoffice, ob an den Küchentisch oder den Platz im Gang, produziert wird, gewinnt der private Kontext und dementsprechend extra-organisationale Erwartungslagerungen einen neuen Zugriff auf die Arbeitenden noch während ihrer Arbeitszeit. Dass dies besonders für Frauen negative Folgen hat, verweist auf die Relevanz des räumlich getrennten Büros für die Emanzipation von Frauen. Umso kritischer sind Bemühungen von Seiten des Gesetzgebers einzuordnen, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice zu etablieren. Denn die unmittelbare Wahlfreiheit zum Homeoffice könnte sich schnell als ungewollte Einschränkung der Freiheitsgrade beruflicher Weiterentwicklung herausstellen, auch nach Wiederöffnung von Kindertagesstätten. An der Schwelle dieses Medienwandels zeigt sich, dass die Differenzierung zwischen Arbeit und Privatem/Familiärem der modernen Gesellschaft vor allem auch durch entsprechende Mediendifferenzen stabilisiert worden ist.
Obgleich wir nach Corona vermutlich mehr digital arbeiten werden, sollten wir zu reflektieren lernen, wo uns dies bei aller Euphorie gesellschaftlich nicht einen zu großen Preis abverlangen könnte. Ausgehend von solchen Reflexionen wird dann auch entscheidbar, wie wir welche Möglichkeitsräume unterschiedlicher Medien neu nutzen und in entsprechende Abfolgen bringen können. Jenseits dieser nötigen Abwägungen ist es mein Eindruck, dass es auch nach der Corona-Krise nicht ohne face-to-face-Interaktion gehen wird und es funktional wie ethisch gesehen auch nicht ohne gehen sollte. Seien wir uns bewusst: Mit der Wahl der Kommunikationsmedien operieren wir am kommunikativen Herzen von Gesellschaft. Zu dieser Vorsicht muss ein mediensoziologischer Blick auf Gesellschaft raten.
Titelbild:
| Samantha Gades / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Bilder im Text:
| LYCS Architecture / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
| Visuals / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Maximilian M. Locher
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm