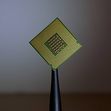Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Abschied in Würde?
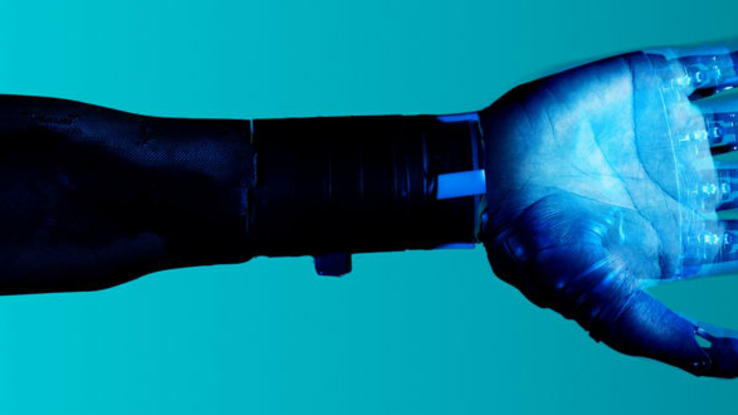

Hans Ulrich Gumbrecht
Gastprofessur für Literaturwissenschaften
- Zur PersonHans Ulrich Gumbrecht
Der gebürtige Würzburger Hans Ulrich Gumbrecht ist ständiger Gastprofessor für Literaturwissenschaften an die Zeppelin Universität. Er studierte Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, Salamanca, Pavia und Konstanz. Seit 1989 bekleidete er verschiedene Professuren für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften der Stanford University. Einem breiteren Publikum ist er bereits seit Ende der 1980er-Jahre durch zahlreiche Beiträge im Feuilleton vor allem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung sowie durch seine Essays bekannt. Darin befasst er sich immer wieder auch mit der Rolle des Sports. Gumbrecht ist bekennender Fußballfan und Anhänger von Borussia Dortmund.
- Mehr ZU|Daily„Das letzte Wort muss immer der Mensch haben“Die Vierte industrielle Revolution wird die Arbeitswelt verändern. Doch welche Fertigkeiten braucht der Mensch von morgen? Eine Frage, mit der sich der emeritierte ZU-Wissenschaftler Nico Stehr intensiv befasst.Unbezahlbare GlücksmomenteDie Digitalisierung der Arbeitswelt betrifft auch die Arbeit an und mit Menschen. Ein Forscherteam um ZU-Professor Manfred Moldaschl und Wissenschaftler Dr. Anil K. Jain versucht, „Anti-Effizienzlogiken“ als Gegengewicht ins Spiel zu bringen.Selbst entscheidenWas ist Künstliche Intelligenz und wie wird sie in den kommenden Jahren die Organisation und Arbeitsweisen der öffentlichen Verwaltung verändern? Diese Fragestellung haben die ZU-Wissenschaftler Professor Dr. Jörn von Lucke und Jan Etscheid untersucht.
In den intensiven Debatten des späten 20. Jahrhunderts über die Geschichte und das Potenzial der Gattung „Mensch“ spielten die Thesen des 1986 verstorbenen französischen Paläontologen André Leroi Gourhan zu den Folgen des „aufrechten Gangs“ für die Evolution des Gehirns und für das Weltverhältnis der vom Gehen befreiten Hände eine zentrale Rolle. Schon damals hat mich allerdings stärker Leroi Gourhans heute kaum mehr erinnerte Reflexion zur Beziehung zwischen den verschiedenen Phasen in der Entwicklung des Menschen fasziniert – und zwar wegen ihrer Bedeutung für den Problemkomplex „Human Enhancement“. Nach einer im normalen (an anderen Stellen heißt es im eher langsamen) biologischen Rhythmus ablaufenden Differenzierung des Homo sapiens aus der Gruppe der Primaten habe dessen Evolution seit dem Einsetzen der „Kultur“, wo immer man chronologisch genau diesen Anfang setzen will, eine enorme Beschleunigung erfahren, eine Beschleunigung, welche sich dann mit der Emergenz der Technologie aus der Kultur seit der Frühen Neuzeit noch einmal exponentiell gesteigert habe.
An dieser komplexen Perspektive schätze ich erstens den naturwissenschaftlich (aber keineswegs mechanistisch) anmutenden Gestus einer Distanz gegenüber euphorischen Selbstfeiern oder moralisierenden Selbstgeißelungen „des Menschen“, wie sie jüngst wieder überhandgenommen haben, und zweitens ihre über jeden Anthropozentrismus hinaus gehende Offenheit für kosmologische Perspektiven.
Schon bevor erste Versionen des Begriffs von einer natürlichen „Evolution“ (zuerst wohl in Frankreich) überhaupt im weiteren Kontext der Ausformung des historischen Weltbilds während der Jahrzehnte nach 1800 auftauchten, hatten Reflexionsschübe der Aufklärung den Menschen als Kollektiv eine Verantwortung und eine Fähigkeit zur Selbstveränderung übertragen. Als emblematische Illustration dieses Schritts in der Entfaltung menschlicher Selbstreferenz gilt noch immer Kants berühmte Formel vom „Heraustreten aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ in seiner Antwort auf die Frage „Was ist Aufklärung?“. Hegels Philosophie vermittelte dann das Moment der Selbststeuerung und dem sich eben erst abzeichnenden historischen Weltbild zur bald nicht mehr allein philosophischen Vision von einem Fortschritt, der zunächst (vor allem in Hegels eigenem Denken) noch auf beschreibbare Zielpunkte ausgerichtet war, um dann bald schon entgrenzt und offen zu werden. Eigentümlich ambivalent wirkt auf uns heute der Status des Menschen in den nun schon bald hervortretenden säkular-mythologischen Diskursen von einem Fortschritt ohne Ende – wie vor allem anhand der Schriften von Karl Marx deutlich wird. Denn der Fortschritt sollte einerseits als „historisch“ und zumal „evolutionär“ garantiert gelten, andererseits aber doch menschlicher Beiträge bedürfen, um gleichsam auf Touren zu kommen.

So gesehen kann es nicht überraschen, dass schon im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Vorläufern des heute fast ausschließlich mit Nietzsche assoziierten Worts vom „Übermenschen“ für die Idee eines Hinausgehens über alle stabilen Selbstdefinitionen auftauchten – vor allem, wohl von wirtschaftlicher Expansion und der Rezeption Darwins getrieben, in den angloamerikanischen Kulturen, etwa bei T. H. Carlyle, W. R. Emerson oder R. A. Wallace. Vor diesem Hintergrund eines hochoptimistischen Zeitgeists wirken Nietzsches einschlägige Reflexionen, zumal die berühmten Passagen aus „Also sprach Zarathustra“, durchaus verhalten. Schon im vierten Abschnitt der „Vorrede“ taucht „ein Seil“ auf, „geknüpft zwischen Thier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde“. Der „Seiltänzer“ – als ein „letzter Mensch“ wohl, der über sich hinaus will – unternimmt das Wagnis des Übergangs, wird nervös in der Gegenwart eines behenden „Possenreißers“, der ihm folgt, um bald „wie ein Wirbel von Armen und Beinen in die Tiefe“ zu stürzen – und verzweifelt über sein Scheitern und den anstehenden Tod von Zarathustra getröstet zu werden: „du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, daran ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Beruf zu Grunde: dafür will ich dich mit meinen Händen begraben.“
Gerade die hier anklingende Zurückhaltung und Skepsis gegenüber den Gelingenschancen der Selbstüberschreitung scheint mir entscheidend für eine denkbare, aber bisher nur selten erwähnte Affinität Nietzsches zu unserer unmittelbaren Gegenwart und vorstellbaren Zukunft. Denn diese Einstellung setzt ja einerseits voraus, dass das Festhalten an einem gegebenen Status verachtenswert, wenn nicht unmöglich ist – keinen metahistorisch normativ gesetzten Begriff der einen „Menschlichkeit“ soll es geben (und klingt uns nicht das Bestehen auf einem normativ und stabil gehaltenen Konzept des Menschseins wachsend banal?). Andererseits ist Zarathustra weit entfernt von einer derzeit noch manchmal lauten Aufregung angesichts der durch Technologie (als „Enhancement“) ermöglichten „Trans-“ oder „Post-Humanismen“ (die aber im Abflauen begriffen ist).
Die mit Leroi Gourhan auf langfristige evolutionäre Tiefenschärfe zugeschnittenen und mit Nietzsche skeptischen Fragen im Blick auf die Gegenwart und für die Zukunft, die ich verfolgen möchte, lauten also: Was sind die spezifischen Schwellen potenzieller Selbstüberschreitung, an denen wir derzeit stehen? Welche Konsequenzen zeichnen sich für den Vollzug der je nächsten Schritte ab? und welche Reaktion auf solche Hochrechnungen von den Konsequenzen des Überschreitens legt eine kosmologische Sichtweise nahe? Als gemeinsamen (und hier nicht weiter zu thematisierenden) Nenner der zu beschreibenden Schwellen setze ich voraus, dass sie als „Human Enhancement“ vor allem dank der exponentiell gewachsenen Rechenkapazitäten elektronischer Technologie in den Blick gekommen sind.
Gleichsam in der Mitte unter diesen Szenarien der Gegenwart steht unsere individuelle Wahrnehmung des Alltags, welche sich derzeit global von einem Feld der Kontingenz zu einem Universum der Kontingenz verschiebt. Dabei entspricht die Formel vom „Feld der Kontingenz“ der seit den bürgerlichen Revolutionen dem Subjekt zugeschriebenen Form der Freiheit. Sie besteht aus einem Horizont von für je verschiedene Entscheidungen offenen Situationen (Kontingenz), der sich zwischen Situationen ohne Freiheit („Notwendigkeit“) und Situationen mit vorgestellter, aber nicht realisierbarer Freiheit („Unmöglichkeit“) erstreckt.
Die beiden das Feld der Kontingenz begrenzenden Pole von „Notwendigkeit“ und „Unmöglichkeit“, meine ich, befinden sich derzeit in einem Schmelzprozess. Wenn sich etwa sexuelle Identität früher als Notwendigkeit aus der Anatomie jeweiliger Genitalien ergab, so hat transsexuelle Chirurgie mittlerweile begonnen, hier einen neuen Bereich der Kontingenz zu eröffnen. Und während Allgegenwart schon immer vorstellbar war, aber als eine für Menschen nicht erreichbare Imagination zum Gottesprädikat wurde, ist inzwischen auch aus dieser Unmöglichkeit eine ganz normale, sich erweiternde Wirklichkeit geworden (ohne die es uns zum Beispiel viel schwerer gefallen wäre, die Corona-Zeit zu überleben). Das fortschreitende Schmelzen der beiden Kontrastpole des Felds von Kontingenz mit seiner Tendenz, in ein Universum von Kontingenz umzuschlagen, muss gewiss als enormer Zuwachs an Freiheit verbucht werden. Doch vor allem schlägt das Universum der Kontingenz existentiell in eine zur Panik schwellende menschliche Angst um, in Absenz des Notwendigen und des Unmöglichen vom Anwachsen alltäglicher Komplexität hoffnungslos überfordert zu werden.
Die zweite Schwelle lässt sich markanter an ein naturwissenschaftliches Ereignis binden, nämlich die Entzifferung des menschlichen Genoms – und an die von ihm untrennbare Utopie, einen in vieler Hinsicht „besseren Menschen“ zu züchten. Auf der Hand lagen hier schon immer eine Reihe von – nicht allein historisch – hochproblematischen Affinitäten. Andererseits habe ich die Logik von Peter Sloterdijks intellektuell riskanter Intervention nie vergessen, nach der es sich die Menschheit nicht leisten kann, diese Chance zur Selbstverbesserung ungenutzt zu lassen. Derzeit scheinen die Visionen von Genmanipulation – wohl aufgrund des Aspekts derzeit noch nicht kontrollierbarer langfristiger Nebenwirkungen – unter ein Tabu gefallen zu sein. Rückgängig und mithin unschädlich können sie allerdings – ebenso wenig wie das Potenzial einer nuklearen Selbstzerstörung der Menschheit – nie mehr gemacht werden.

Künstliche Intelligenz als dritte Schwelle sollte streng genommen gar nicht mehr zum Menschen-betriebenen „Enhancement“ gerechnet werden, weil seit einigen Jahren schon die Algorithmen der Software selbst via „Deep Learning“ beschleunigend den Vollzug immer neuer Schritte hin zu einer der menschlichen überlegenen Intelligenz vollziehen. Nicht auszuschließen, dass eine solche machtvollere Intelligenz bereits existiert und die Menschheit ohne deren Wissen steuert (hier konvergieren Corona-ausgelöste und wahrscheinlich paranoide Fantasien von der Menschheitsmanipulation mit der erschreckenden Hochrechnung realistisch denkbarer Entwicklungen). Nachdem sich im Zukunftsblick auf eine solche von Menschen ausgelöste Möglichkeit der Gedanke jedenfalls nicht mehr neutralisieren lässt, dass Künstliche Intelligenz die Menschheit unterwerfen oder sogar eliminieren könnte, haben auch hier (vielleicht zu spät) politische Diskussionen zur Unterbindung potenzieller Fortschritte eingesetzt, deren je nächster der sprichwörtliche „Schritt zu viel“ sein könnte.
Am deutlichsten hörbar freilich, vor allem in Bezug auf die Konsequenzen, ist die derzeit durchaus „politische“ Rede von einer Schwelle „in Gegenrichtung“, von einer Schwelle, die wir schon überschritten haben könnten – ohne dass die Möglichkeit einer Umkehr zurück zum Erhalt der Menschheit auf der Erde verbleibt. Es handelt sich um jene Schwelle, die vor allem mit bedrohlichen Syndromen wie dem „Klimawandel“ verbunden wird, aber und auch mit dem abstrakteren Konzept des „Anthropozäns“, als der Zeitspanne zwischen den ersten schädlichen Auswirkungen menschlicher Präsenz auf die Biosphäre des Planeten und dem in nähere oder ferne Zukunft projizierten, meist als „selbstverschuldet“ gedeuteten Ende dieser Präsenz.
Rhetorisch wie politisch gesehen haben die Untergangsszenarien solch pessimistischer Tönung – intensiviert durch die Furcht vor den Folgen einer fahrlässigen Überschreitung anscheinend noch vor uns liegender Schwellen (wie „Alltag als Universum der Kontingenz“, „Genmanipulation“, „Künstliche Intelligenz“) – machtvolle Vorschläge und beginnende Energien zur kollektiven, ökologisch motivierten Selbsteinschränkung der Menschen mit globaler Wirkung auf den Weg gebracht. Ihr gemeinsames Ziel ist die aktive Aufhebung der von Leroi Gourhan skizzierten Dynamik einer beschleunigenden Evolution in den nicht-biologischen Medien von Kultur und Technologie – mit dem Letztziel einen langfristigen, wenn nicht unbegrenzten Erhalt menschlichen Lebens auf dem Planeten.
Wie sieht es aus kosmologischer Perspektive um die Chancen und um den Status dieser Selbstrettungsstrategie der Menschheit? Obwohl sie nur die Menschen-getragene Dimension der Evolution anvisiert, wird der Drang nach kollektiver Selbsterhaltung generell als alternativlos und mithin als „natürlich“ erlebt. Dagegen ließe sich zunächst einwenden, dass nach aller Wahrscheinlichkeit keine andere biologische Gattung auf unserem Planeten je eine Vorstellung von ihrer eigenen Zukunft gehabt hat. Mit anderen Worten: Der unbegrenzte Erhalt der Menschheit ist ein durchaus anthropozentrisches Ziel ohne denkbare ökologische Rechtfertigung. Unter dieser Voraussetzung aber taucht die kaum je diskutierte Frage auf, wie einschneidend die zum langfristigen Erhalt der Menschheit notwendigen Einschränkungen denn wären – und ob wir (die gegenwärtigen und die anstehenden Generationen) tatsächlich bereit sind, einen wohl grundsätzlichen existentiellen Verzicht zugunsten von Menschen einer entfernten Zukunft hinzunehmen. Dies einmal ganz abgesehen von der nicht aufzuhebenden Ungewissheit hinsichtlich des Erfolgs solcher Opfer.
Kosmologisch gesehen erscheint das Ende der Menschheit jedenfalls als der anzunehmende Normalfall, woraus – ganz im Gegensatz zur Alternativlosigkeit der maximalen Selbsterhaltung – als Alternative die Frage hervorgeht, ob sich die Menschheit auf einen Abschied in Würde vom Planeten einstellen könnte. Wenn immer ich freilich in den vergangenen Jahren diesen Gedanken formuliert habe, bin ich auf Lachen gestoßen, ausgelöst offenbar von dem Missverständnis, er sei das Ergebnis eines ironischen Impulses. Mich hat diese Reaktion eher an Passagen bei Nietzsche erinnert, wo Zarathustra vom Lachen – und vom Tanzen – als Symptomen der Schwelle zwischen dem Menschen und dem Übermenschen spricht: „Wie vieles ist noch möglich! Lernt über euch selbst lachen, wie man lachen muss!“ Anders gesagt: Könnten wir, ohne es bisher geahnt zu haben, an einer Schwelle zum Übermenschen stehen?
Natürlich kann es nicht im Ernst um die Vermessenheit gehen, einen eigenen Gedanken – als Symptom – in der Nachbarschaft des Begriffs vom „Übermenschen“ zu platzieren. Für relevant halte ich an dieser Stelle der Reflexion jedoch die Konvergenz zwischen dem Übermenschen und dem Motiv von der „ewigen Wiederkunft“, das Nietzsche ja aus den kosmologischen Überlegungen seiner Zeit übernommen hatte und philosophisch weiterentwickelte. Zur Zeitlichkeit der ewigen Wiederkunft sollen Phasen des Untergangs gehören und für die Weiterführung dieser Einsicht von der Möglichkeit oder gar der Unvermeidlichkeit eines Endes der Menschheit als Erfüllung des Übermenschen gibt es Text-Evidenz: „Zarathustra aber fragt als der Einzige und Erste: wie wird der Mensch überwunden? Der Übermensch liegt mir am Herzen, der ist mein Erstes und Einziges, – und nicht der Mensch: nicht der Nächste, nicht der Ärmste, nicht der Leidenste, nicht der Beste – Oh meine Brüder, was ich lieben kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang ist und ein Untergang.“ Hier erscheint der Übermensch als derjenige, der – im Kontext der ewigen Wiederkunft – um das Verschwinden der Menschen weiß. Nicht textuell zu entscheiden scheint, ob der Untergang auch den Übermenschen betreffen wird, der um ihn weiß. Wenige Sätze weiter stößt man auf eine Intuition, welche dies nahezulegen scheint. Sie führt den Gedanken von der Einsicht in den Untergang des Menschen als Teil der ewigen Wiederkunft weiter zu der Vorstellung darüber, wie sich ein Abschied der Menschen vom Planeten Erde „in Würde“ vollziehen könnte: „Herz hat, wer Furcht kennt, aber Furcht zwingt; wer den Abgrund sieht, aber mit Stolz.“
Friedrich Nietzsche gehört zu jenen Philosophen, deren Texte ihre – auch entfernten – Leser zu eigenen Gedanken ermutigen, statt ihnen die Übernahme nahtloser Argumente aufzuerlegen. Welche Begriffe und Bilder ihm unsere Gegenwart als eine Zeit vielfältig dramatischer Schwellen abverlangt hätte, werden wir nie wissen. Doch seine Gedanken können Gespräche über diese Gegenwart eröffnen, für die ein Abschied der Menschen vom Planeten zur Bejahung des Lebens im kosmologischen Sinn wird. Gerade weil die Evolution der Menschen, wie André Leroi Gourhan bemerkte, von der biologischen Dynamik abgewichen war und sie durch Kultur und Technologie ersetzt hatte, sind wir grundsätzlich fähig und frei, das Ende des Überlebens als Bejahung des biologischen Lebens zu sehen und zu wählen.
Dieser Artikel ist am 1. Februar unter dem Titel „An der Schwelle zum Übermenschen – oder in die Gegenrichtung?“ im Schweizer Monat (Ausgabe 1083 – Februar 2021) erschienen.
Titelbild:
| ThisisEngineering RAEng / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Bilder im Text:
| Pieter Bruegel der Ältere / de.wikipedia.org (Gemeinfrei) | Link
| Piotr Bene / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Hans Ulrich Gumbrecht
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm